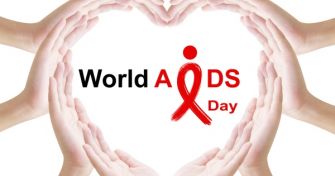Die Pille: wichtige Fakten und Fragen im Überblick
Die Pille galt einst als bahnbrechende Errungenschaft für die Selbstbestimmung der Frau. Und auch aus pharmazeutischer und arzneimittelrechtlicher Sicht war und ist sie außergewöhnlich. Denn im Vergleich zu fast allen anderen Arzneimitteln bekämpft sie keine krankhaften Beschwerden oder schützt prophylaktisch davor. Stattdessen zählt sie heute zu den bekanntesten Formen der Empfängnisverhütung.
Inhaltsverzeichnis
Welche verschiedenen Arten von Antibabypillen gibt es?
Für wen ist die Pille geeignet?
Für wen ist die Pille nicht geeignet?
Was sind die Vorteile der Pille?
Was sind die Nachteile der Pille?
Was ist bei der Einnahme der Pille zu beachten?
Kann man die Pille durchnehmen oder muss pausiert werden?
Was sind die häufigsten Einnahmefehler in Bezug auf die Pille?
Warum kann man trotz Einnahme der Pille schwanger werden?
Was tun bei Zwischenblutungen trotz Pille?
Kann mit der Pille in der Stillzeit verhütet werden?
Wie kann die Pille abgesetzt werden?
Was macht es mit dem Körper, wenn man die Pille wieder absetzt?
Wie lange dauert es nach der Einnahme der Pille schwanger zu werden?
Wer übernimmt die Kosten für die Pille?
Im Jahr 2023 verhüteten laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 38 Prozent der Frauen zwischen 18 und 49 Jahren mit oralen Kontrazeptiva. Demnach sind Pille und Kondom immer noch die wichtigsten Verhütungsmittel unter sexuell aktiven Erwachsenen in Deutschland. Im Vergleich zur Vorgängerstudie von 2011 nahm der Kondomgebrauch allerdings zu, während orale Kontrazeptiva an Zuspruch verloren. Vor allem bei Frauen zwischen 18 und 29 Jahren zeigte sich „eine eher kritische Einstellung zu hormonellen Verhütungsmethoden“. Denn trotz der mittlerweile optimierten Dosierung und stetigen Weiterentwicklung ist die Pille nicht nebenwirkungsarm. Und auch wenn sie eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann, bietet sie keinen Schutz vor übertragbaren Krankheiten
- Eine Frau würde ohne Verhütung in ihrem Leben 10-20 Kinder gewähren.
- Carl Djerassi, der Entwickler der Pille, liess sich selbst sterilisieren.
- Die Arzneiform „Pille“ findet schon lange keine Verwendung mehr. Bei der Antibabypille handelt es sich eigentlich um Filmtabletten oder Dragees.
- Frauen, die die Pille nehmen, blinzeln im Schnitt 32 Prozent häufiger.
- Die Pille kann Einfluss auf die Partnerwahl nehmen.
Die Geschichte der Pille
Die Suche nach zuverlässigen Methoden zur Empfängnisverhütung reicht bis in die Antike zurück. Damals wurden die ersten Kondome in Form von Tierdärmen oder Schwimmblasen von Fischen verwendet. Im 19. Jahrhundert entstand schließlich die Idee der hormonellen Verhütung. Wissenschaftler[1] erkannten, dass Hormone eine Schlüsselrolle bei der Regulierung des weiblichen Zyklus spielen. Den Anstoss zur Pille gaben zwei Frauenrechtlerinnen – die Krankenschwester Margaret Sanger und die Biologin Katharine McCormick. Ihr Ziel war es, vor allem illegale Abtreibungen zu verhindern. Entwickelt durch den Chemiker Carl Djerassi, wurde 1960 in den USA „Enovid“ zur hormonellen Empfängnisverhütung zugelassen.
Am 1. Juni 1961 revolutionierte das Präparat „Anovlar“ als erstes orales Kontrazeptivum den westdeutschen Arzneimittelmarkt. Als Mittel gegen Menstruationsbeschwerden war es anfangs nur verheirateten Frauen mit mehreren Kindern vorbehalten; die Empfängnisverhütung wurde lediglich als Nebenwirkung im Beipackzettel aufgeführt. Vier Jahre später erfolgte die Markteinführung in der DDR unter dem Namen „Ovosiston“. Auch hier wurde das Medikament anfänglich nur in speziellen Fällen verschrieben, später aber offensiv als „Wunschkindpille“ zur Familienplanung eingesetzt. Verglichen mit aktuellen Pillen handelte es sich bei beiden Präparaten um wahre Hormonbomben: Eine einzige Tablette enthielt eine so hohe Östrogendosis, wie sie heutzutage in einer kompletten Monatspackung enthalten ist.
Inzwischen sind über 50 verschiedene Antibabypillen auf dem Markt, die sich in mehrere Gruppen unterteilen lassen: kombinierte Pillen, deren Wirkprinzip auf einer Mischung von Östrogenen und Gestagenen beruht und reine Gestagen-Pillen, die nur einen hormonell wirksamen Bestandteil enthalten.
Der weibliche Zyklus
Um das Wirkprinzip der Antibabypille zu verstehen, ist ein Blick auf den normalen Hormonhaushalt essenziell. Gesteuert durch das Zusammenspiel verschiedener Hormone, besteht jeder Zyklus aus zwei Hälften. Während der erste Abschnitt in seiner Dauer sehr variabel sein kann, erstreckt sich die zweite Zyklushälfte recht konstant über knapp 14 Tage.
1. Eireifungsphase (Follikelphase)
Der Menstruationszyklus beginnt mit dem ersten Tag der Regelblutung, mit der das unbefruchtete Ei zusammen mit der Gebärmutterschleimhaut abgestoßen und über die Scheide ausgeschieden wird. Gleichzeitig reifen unter dem Einfluss des Follikelstimulierenden Hormons (FSH) in den Eierstöcken sogenannte Follikel (Eibläschen) heran, die die Eizellen enthalten. In den Follikeln bildet sich das Hormon Östrogen, das die Gebärmutter darauf vorbereitet, eine befruchtete Eizelle zu empfangen. Die Gebärmutterschleimhaut wird wieder aufgebaut und das Sekret im Gebärmutterhals verflüssigt. Samenzellen wird so das Eindringen in die Gebärmutterhöhle erleichtert.
2. Sekretionsphase (Lutealphase)
Die 2. Zyklushälfte beginnt mit dem Eisprung. Ausgelöst durch das luteinisierende Hormon (LH) platzt ein Follikel und gibt eine Eizelle frei. Das reife Ei wandert vom Eierstock in den Eileiter und hinterlässt den Gelbkörper. Dieser bildet das Gelbkörperhormon (Progesteron), das für die Erhaltung der Frühschwangerschaft wichtig ist.
Nach dem Eisprung bleibt die reife Eizelle für 12 bis 24 Stunden befruchtungsfähig. Kommt es zu einer Befruchtung durch eine männliche Samenzelle, wandert die Eizelle innerhalb der nächsten Tage durch den Eileiter zur Gebärmutter und nistet sich dort ein.
Hat im Eileiter keine Befruchtung der Eizelle stattgefunden, fällt der Progesteronwert ab, wodurch die Regelblutung ausgelöst wird.
Im Durchschnitt erstreckt sich der weibliche Zyklus über 28 Tage, individuelle Schwankungen zwischen 21 und 35 Tagen sind normal. Der Menstruationszyklus und damit auch die Zykluslänge unterliegen dem Einfluss zahlreicher Faktoren – von seelischem und körperlichem Stress, Veränderungen der Lebensgewohnheiten bis hin zu Unter- oder Übergewicht. Starkes Rauchen sowie chronischer und exzessiver Alkoholkonsum können sich ebenfalls auf die Zykluslänge auswirken. Ein konstant unregelmäßiger Zyklus kann ein erstes Anzeichen für gesundheitliche Probleme sein und sollten stets ärztlich abgeklärt werden.
Wie wirkt die Pille?
Orale Kontrazeptiva greifen in das fein abgestimmte Zusammenspiel der körpereigenen Hormone ein. FSH und LH werden nur dann gebildet, wenn die Spiegel von Progesteron und Östrogen schwanken. Durch die konstante Hormonzufuhr wird dem Körper vorgetäuscht, dass eine Schwangerschaft vorliegt. Die natürlichen Hormonschwankungen, die normalerweise im Zyklus auftreten, werden unterdrückt. In Folge kommt es zu folgenden empfängnisverhütenden Effekten:
Unterdrückung des Eisprungs:
Der LH-Anstieg wird hemmt. In Folge findet kein Eisprung statt und es gibt kein Ei, das befruchtet werden kann.
Veränderung der Gebärmutterschleimhaut:
Die Pille bewirkt eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, sodass die Einnistung eines befruchteten Eis verhindert wird.
Veränderung des Zervixschleims:
Unter dem Einfluss der Pille wird der Zervixschleim dicker, was das Eindringen von Spermien erschwert. Dies verringert ebenfalls die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung.
Welche verschiedenen Arten von Antibabypillen gibt es?
Je nach Pillen-Sorte unterscheidet sich die Wirkstoffzusammensetzung und -konzentration mit der eine Schwangerschaft verhindert wird:
Minipille
Sogenannte Minipillen sind reine Gestagen-Pillen. Sie enthalten als Wirkstoff ein synthetisches Gelbkörperhormon, das ähnlich wirkt wie das körpereigene Progesteron. In Deutschland wird hierzu auf die Wirkstoffe Levonorgestrel oder Desogestrel zurückgegriffen. Beide sorgen dafür, dass sich der Schleim im Gebärmutterhals so verfestigt, dass keine Spermien in die Gebärmutter eindringen können. Außerdem baut sich die Gebärmutterschleimhaut nur unzureichend auf, sodass sich eine befruchtete Eizelle nur schwer einnisten kann. Die etwas höher dosierte Minipille mit dem Hormon Desogestrel hemmt zusätzlich noch den Eisprung.
Mikropille/Kombinationspille
Spricht man heutzutage von „der Pille“, ist in den meisten Fällen von der Mikropille die Rede. Hierbei handelt es sich um ein niedrig dosiertes Kombinationspräparat mit einem Östrogen und einem Gestagen. Fast alle Präparate beinhalten das Östrogen Ethinylestradiol, während die Art des Gestagens variiert. Die Bezeichnung „Mikropille“ bezieht sich primär auf die geringeren Östrogenmengen im Vergleich zu früheren Pillenpräparaten. Das Östrogen verhindert die Reifung der Eizelle und den Eisprung. Durch das enthaltene Gestagen bildet sich ein Schleimpfropf, der den Gebärmutterhals verschließt, sodass keine Spermien eindringen können. Außerdem reduziert das synthetische Gelbkörperhormon den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Sollte es Spermien dennoch gelingen, den Schleimpfropf zu durchdringen und eine Eizelle zu befruchten, besteht für diese keine Möglichkeit sich einzunisten.
Einteilung nach Generationen
Seit ihrem Markteintritt werden orale Kontrazeptiva stetig weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es vier verschiedene Mikropillen-Generationen auf dem Arzneimittelmarkt, die sich in Dosierung, Art und Zusammensetzung der synthetisch hergestellten Hormone unterscheiden. Die Einteilung nach Generationen war ursprünglich ein Marketinginstrument der Pharmaindustrie, um neue Präparate als fortschrittliche Alternativen auf dem Markt zu etablieren. Moderne Antibabypillen der dritten und vierten Generation versprechen hierbei positive Effekte für Haut und Haare, allerdings bergen sie ein bis zu doppelt so hohes Risiko für Thrombosen und Lungenembolien im Vergleich zu älteren Kontrazeptiva.
Für wen ist die Pille geeignet?
Voraussetzung für die Verordnung der Pille ist eine umfassende gynäkologische Untersuchung. In einem ausführlichen Beratungsgespräch wird festgelegt, ob und welche der verschiedenen Pillenarten für eine Frau geeignet ist. Hierbei werden neben dem allgemeinen Gesundheitszustand auch mögliche Risikofaktoren wie Rauchen oder Bluthochdruck berücksichtigt.

Prinzipiell können orale Kontrazeptiva besonders für Frauen sinnvoll sein, die regelmäßig Sex haben und eine konstante Verhütungsmethode bevorzugen. Aber auch bei unregelmäßigen Zyklen sowie starken Menstruationsbeschwerden wie Schmerzen, Krämpfen oder starken Blutungen kann die Antibabypille zum Einsatz kommen. Einige Präparate können dazu beitragen, Akne zu reduzieren oder zu verbessern, indem sie den Hormonhaushalt stabilisieren. Für Frauen, die keine Hormonspirale, Vaginalringe oder Verhütungsstäbchen vertragen, kann die Pille eine alternative hormonelle Verhütungsmethode sein.
Für wen ist die Pille nicht geeignet?
Wie bei allen Arzneimitteln gibt es auch bei der Antibabypille bestimmte Faktoren und Erkrankungen, die absolute Kontraindikationen darstellen. In diesen Fällen sollte unbedingt auf eine hormonfreie Verhütungsmethode zurückgegriffen werden:
- Schwere Erkrankungen der Leber oder Gallenblase
- Ungeklärte vaginale Blutungen
- Schwangerschaft
- Tumore, deren Wachstum durch weibliche Geschlechtshormone gefördert wird (Geschlechtshormonabhängige Tumore)
In Bezug auf ein erhöhtes Thromboserisiko sind besonders Kombinationspillen bei folgenden Risikofaktoren nicht geeignet:
- Gerinnungsstörungen wie eine erhöhte Gerinnungsneigung
- Gefäßerkrankungen in der Vergangenheit wie Thrombose oder eine Lungenembolie
- Alter; Frauen über 40 Jahren sollten keine Kombinationspräparate einnehmen
- Rauchen
- Bluthochdruck
- Übergewicht
- Diabetes
Ab wann wirkt die Pille?
Damit die Pille sofort vor einer Empfängnis schützt, wird die Einnahme am ersten Tag der Monatsblutung empfohlen. Ist sichergestellt, dass keine Schwangerschaft besteht, kann auch an jedem anderen Tag mit der Anwendung begonnen werden. In diesem Fall dauert es in der Regel sieben Tage, bis sie vollen Empfängnisschutz bietet. In diesem Zeitfenster wird die Verwendung zusätzlicher Verhütungsmethoden wie Kondome empfohlen, um einen zusätzlichen Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft zu gewährleisten.
Wie sicher ist die Pille?
Die Pille ist ein sehr zuverlässiges Kontrazeptivum – allerdings nur, wenn sie regelmäßig und nach Vorschrift eingenommen wird.
Der sogenannte „Pearl Index“ sagt aus, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Er gibt an, wie viele Frauen von 1000 ungewollt schwanger werden, wenn sie ein Jahr lang eine bestimmte Verhütungsmethode anwenden. Das bedeutet also konkret: Je kleiner der Pearl-Index ist, desto sicherer ist das betreffende Verhütungsmittel.
Je nach Zusammensetzung liegt der Wert für die Mikropille bei 0,1-0,9 – bei 1000 Frauen, die ein Jahr lang mit dem gleichen Kombinationspräparat verhüten, versagt der Empfängnisschutz nur in ein bis neun Fällen. Die Minipille hat einen etwas höheren Pearl-Index von 0,4 bis 4,1 – sie gilt somit ebenfalls als sehr zuverlässig.
Was sind die Vorteile der Pille?
Die Einnahme der Pille kann einige potenzielle Vorteile bieten – auch über die primäre Funktion der Schwangerschaftsverhütung hinaus. Sie können jedoch von Frau zu Frau variieren und sollten stets gegenüber möglichen Risiken und Nebenwirkungen abgewägt werden.
Regelmäßige und beschwerdefreiere Menstruationszyklen
Orale Kontrazeptiva können dazu beitragen, den Menstruationszyklus zu regulieren und Menstruationsbeschwerden wie Schmerzen, Krämpfe und unregelmäßige Blutungen zu reduzieren.
Vermindertes Risiko bestimmter Erkrankungen
Die Pille kann das Risiko einiger gesundheitlicher Probleme wie Eierstock- und Gebärmutterhalskrebs, Akne oder Ovarialzysten minimieren. Durch die Reduzierung von Menstruationsblutungen kann die Pille außerdem das Risiko einer Eisenmangelanämie verringern.
Verbesserte Symptomatik bestimmter Erkrankungen
Bei gynäkologischen Erkrankungen wie Endometriose und PCOS (Polyzystisches Ovarialsyndrom) kann die Regulation des Menstruationszyklus helfen, Symptome wie Schmerzen und unregelmäßige Blutungen zu verbessern.
Kontrolle hormonbedingter Beschwerdebilder
Hormonbedingte Beschwerden wie Prämenstruelles Syndrom (PMS) und menstruationsbedingte Migräne können durch den Ausgleich von Hormonschwankungen gelindert werden.
Was sind die Nachteile der Pille?
Obwohl orale Kontrazeptiva viele Vorteile bieten, ist ihre Einnahme auch mit einigen Nachteilen und Risiken verbunden:
Kein Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STIs)
Die Pille bietet keinen Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen. Daher ist es wichtig, zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Kondome zu verwenden, um das Risiko einer Ansteckung zu verringern.
Anwendungsfehler
Die Wirksamkeit der Pille hängt stark von ihrer regelmäßigen und korrekten Anwendung ab. Vergessene Pillen, Durchfall, Erbrechen oder Wechselwirkungen mit Medikamenten können die Wirksamkeit beeinträchtigen und das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft erhöhen.
Nebenwirkungen
Einige Frauen leiden unter Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen, Brustspannen, Gewichtszunahme, Libidoverlust und Stimmungsschwankungen, insbesondere während der Anpassungsphase an die Pille oder bei dem Wechsel zu einem anderen Präparat. Obwohl viele Studien auf ein erhöhtes Risiko für Depressionen, Suizid und generell psychische Probleme in Zusammenhang mit der Pille hindeuten, wird dies oftmals als unbedeutend abgetan. Hormone haben jedoch einen wesentlichen Einfluss auf die Stimmung: ungefähr 15 Prozent aller Stimmungsstörungen sind hormonell bedingt.

Erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko
Einige Studien zeigen, dass die Einnahme der Pille das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall leicht erhöhen kann – vornehmlich bei Frauen, die rauchen oder andere Risikofaktoren aufweisen.
Erhöhtes Brustkrebsrisiko
Es gibt Hinweise darauf, dass die langfristige Einnahme der Pille das Risiko für Brustkrebs leicht erhöhen kann.
Erhöhtes Thromboserisiko
Die Einnahme der Pille, insbesondere von Kombinationspillen, kann das Risiko für die Bildung von Blutgerinnseln (Thrombosen) erhöhen und zu ernsthaften gesundheitlichen Komplikationen wie Venenthrombosen oder Lungenembolien führen. Besonders moderne Antibabypillen der dritten und vierten Generation bergen hierfür ein bis zu doppelt so hohes Risiko im Vergleich zu älteren Kontrazeptiva. Rauchen, starkes Übergewicht, eine familiäre Veranlagung für Gefäßerkrankungen und Bluthochdruck wirken sich ebenfalls negativ auf das Thromboserisiko aus. Frauen mit einem oder mehreren dieser Risikofaktoren sollten daher auf Gestagene der 3. und 4. Generation verzichten. Bei einer längeren Immobilisierung und bestimmten operativen Eingriffen sollte die Einnahme der Kombinationspille unterbrochen und vorübergehend auf eine andere Verhütungsmethode zurückgegriffen werden.
Eine Flugreise mit einer Dauer von mehr als 4 Stunden kann besonders bei vorbelasteten Patientinnen ebenfalls einen Risikofaktor darstellen. Sie sollten während des Fluges auf vorbeugende Maßnahmen wie gelegentliches Aufstehen, ausreichende Flüssigkeitszufuhr, Alkoholverzicht und das Tragen von Kompressionsstrümpfen zurückgreifen. Ein Gespräch mit dem behandelnden Arzt bringt Klarheit, ob medikamentöse Maßnahmen zur Thromboseprophylaxe ergriffen werden sollten.
Was ist bei der Einnahme der Pille zu beachten?
Minipille (reine Gestagen-Pille)
Die Minipille wird ohne Pause eingenommen. Ist eine Blisterpackung aufgebraucht, wird die Einnahme ohne Unterbrechung am nächsten Tag mit einem neuen Streifen fortgesetzt.
Levonorgestrelhaltige Minipillen sollten möglichst immer zur selben Tageszeit mit einer Toleranz von maximal drei Stunden eingenommen werden. Präparate mit dem Wirkstoff Desogestrel können innerhalb eines Zeitfensters von bis zu 12 Stunden eingenommen werden, ohne dass der Verhütungsschutz beeinträchtigt ist.
Mikropille (Kombinationspillen)
Bei Einphasenpillen enthält jedes der 21 oder 22 Dragees eines Blisters die gleiche Menge an Östrogen und Gestagen. Nach einer sieben- beziehungsweise sechstägigen Einnahmepause, in der eine Hormonentzugsblutung einsetzt, wird dann mit einem neuen Streifen begonnen.
Einphasenpräparate mit 28 Dragees pro Blister werden ohne Unterbrechung eingenommen. Die letzten sieben Pillen sind wirkstofffrei und daher meist andersfarbig. Sie dienen lediglich dazu, Einnahmefehler zu vermeiden, daher muss die Einnahmereihenfolge genau eingehalten werden. Die Entzugsblutungen treten während der Einnahme der wirkstofffreien Tabletten ein.
Bei Zwei- oder Dreiphasenpräparaten unterscheidet sich der Hormongehalt der Dragees auf dem Blisterstreifen. Dadurch sollen die Hormonschwankungen eines normalen Zyklus nachgeahmt und mögliche Nebenwirkungen reduziert werden. Die Dragees haben unterschiedliche Farben und müssen ebenfalls genau in der vorgeschriebenen Reihenfolge eingenommen werden, um die Sicherheit der Verhütung zu gewährleisten.
Kann man die Pille durchnehmen oder muss pausiert werden?
Die Pille „durchnehmen“ bedeutet, das Kontrazeptivum über längere Zeit ohne Pause und Abbruchblutung einzunehmen – die Anwendung erfolgt dann im sogenannten Langzyklus. Offiziell zugelassen sind in Deutschland hierfür allerdings nur wenige Präparate. Nach ärztlicher Rücksprache ist jedoch bei den meisten Einphasen-Mikropillen auch eine durchgängige Einnahme möglich. Üblicherweise wird das 84/7-Schema empfohlen: Die Einnahme erfolgt über zwölf Wochen, gefolgt von einem siebentägigen hormonfreien Intervall, in dem eine Entzugsblutung eintritt. Besonders für Frauen mit einer starken Menstruationsblutung, mit ausgeprägten Regelschmerzen oder zyklusabhängigen Migräneattacken kann dies Vorteile bieten. Im Gegenzug kann es besonders am Anfang des Langzyklus zu unregelmäßigen Minimal- und Zwischenblutungen kommen. Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass trotz der niedrigen Dosierung der Mikropille, die Gesamtdosis der Hormone im Langzyklus höher ist als bei der herkömmlichen Pilleneinnahme.
Was sind die häufigsten Einnahmefehler in Bezug auf die Pille?
Pille vergessen
Wurde die Einnahme vergessen, sollte so schnell wie möglich die nächste Pille eingenommen werden. Je nach Zeitpunkt und Präparat hat eine vergessene Einnahme unterschiedliche Auswirkungen auf den Verhütungsschutz.
Durchfall/Erbrechen
Bei Durchfall und/oder Erbrechen innerhalb von vier Stunden nach Einnahme der Pille besteht kein sicherer Empfängnisschutz mehr.
Alkohol/Drogen
Nach Drogen- oder Alkoholkonsum kann die Pille leichter vergessen oder erbrochen werden.
Zeitverschiebung auf Reisen
Bei Reisen in eine andere Zeitzone muss die Zeitverschiebung bei der Einnahme berücksichtigt werden.
Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten
Einige Arzneistoffe können die Wirkung der Pille beeinträchtigen. Hierzu zählen unter anderem: Antibiotika, Johanniskraut, Blutdruck- und Cholesterinsenker, Abführmittel, Rheumamittel, Antiepileptika, Mittel gegen Pilzinfektionen (Antimykotika), Antidiabetika, Mittel gegen Tuberkulose und Mittel gegen eine HIV-Infektion/AIDS.
Warum kann man trotz Einnahme der Pille schwanger werden?
Prinzipiell ist keine Verhütungsmethode zu 100 Prozent sicher, so dass immer ein geringes Restrisiko einer Schwangerschaft bestehen kann. Warum eine Frau trotz Einnahme der Pille schwanger wird, kann aber auf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Der Hauptgrund liegt normalerweise an Unregelmäßigkeiten oder Fehlern bei der Einnahme. Aber auch Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wie Antibiotika oder bestimmte Antiepileptika können die Wirksamkeit der Antibabypille beeinträchtigen. Verdauungsstörungen können die Wirkstoffaufnahme negativ beeinflussen und ebenfalls das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft erhöhen. In seltenen Fällen kann die Wirksamkeit aufgrund fehlerhafter Pillenchargen oder falscher Lagerbedingungen eingeschränkt sein.
Was tun bei Zwischenblutungen trotz Pille?
Zwischenblutungen in der Anpassungsphase der Pille sind ganz normal. Besonders zu Beginn der hormonellen Verhütung oder bei einem Wechsel auf ein anderes Pillenpräparat können Hormonschwankungen zu atypischen Blutungen führen. Bei länger anhaltenden Zwischenblutungen und/oder ungewöhnlichen Begleiterscheinungen, wie starken Schmerzen oder Fieber, sollte in jedem Fall ein Arzt zurate gezogen werden.
Aber auch nach Einnahmefehlern können Zwischenblutungen auftreten. Eine vergessene Pille, eine zu späte Einnahme, Erbrechen oder Durchfall in den ersten vier Stunden nach der Einnahme – all dies kann dafür sorgen, dass die Hormonspiegel aus dem Gleichgewicht geraten.
Des Weiteren können organische Ursachen wie beispielsweise Geschlechtskrankheiten, Stoffwechselstörungen, Endometriose unplanmäßige Blutungen hervorrufen.
Kann mit der Pille in der Stillzeit verhütet werden?
Während der Stillzeit können nicht alle Pillenpräparate eingenommen werden. Die Kombinationspille ist für Stillende ungeeignet, da der Säugling durch die Muttermilch eine zu große Hormonmenge aufnehmen würde. Des Weiteren kann es durch die Östrogenwirkung zur Einstellung des Milchflusses kommen. Die Minipille enthält nur ein Gelbkörperhormon in sehr niedriger Dosierung und eignet sich deshalb sehr gut zur Verhütung in der Stillzeit. Mit ihrer Einnahme sollte frühestens sechs Wochen nach der Entbindung begonnen werden.
Wie kann die Pille abgesetzt werden?
Prinzipiell kann die Pille von heute auf morgen abgesetzt werden. Empfehlenswert ist eine Pillenpause aber generell am Ende eines Zyklus und erst ab einem Einnahmezeitraum von etwa sechs Monaten. Kürzere Intervalle bringen den Hormonhaushalt zu häufig und zu stark durcheinander.
Das Führen eines Regelkalenders kann im Anschluss helfen, den natürlichen Zyklus besser kennenzulernen. Wenn die Pille aus gesundheitlichen Gründen verschrieben wurde, empfiehlt es sich, das Absetzen mit dem verordnenden Arzt im Vorfeld zu besprechen.
Was macht es mit dem Körper, wenn man die Pille wieder absetzt?
Mit der Einnahme der Pille wird in die natürlichen Vorgänge im Körper eingegriffen und der Zyklusablauf kontrolliert. Mit dem Absetzen wird diese Rolle wieder von den körpereigenen Hormonen Östrogen und Progesteron übernommen. In Folge werden das Heranreifen der Eizelle, der Eisprung sowie die Periode wieder vom Körper selbst reguliert. Diese Rückkehr zu den natürlichen Abläufen geschieht häufig nicht vollkommen reibungslos, da der Körper die hormonelle Veränderung nicht auf Knopfdruck ausbalancieren kann. Die damit einhergehenden Symptome werden umgangssprachlich als „Post-Pill-Syndrom“ zusammengefasst:
Zyklusunregelmäßigkeiten
Nach dem Absetzen der Pille kann es einige Zeit dauern, bis der natürliche Menstruationszyklus wiederhergestellt ist. Als Folge können unregelmäßige Perioden, längere oder kürzere Zyklen sowie Ausbleiben der Menstruation beobachtet werden.
Hautveränderungen und temporärer Haarausfall
Einige Frauen berichten von Hautveränderungen wie Akne oder unreiner Haut sowie verstärktem Haarausfall nach Absetzen der Pille.
Stimmungsschwankungen
Nach Beendigung der Pilleneinnahme können Stimmungsschwankungen oder emotionale Veränderungen beobachtet werden. Auch dies kann auf die plötzliche Umstellung der Hormonspiegel im Körper zurückzuführen sein.
Gewichtsveränderungen
Die Pille täuscht dem Körper permanent eine Schwangerschaft vor, deswegen steigert sich oft der Appetit und es treten häufiger Wassereinlagerungen im Körper auf. In Folge kommt es zu einer Gewichtszunahme, die nach dem Absetzten wieder reversibel ist.
Verbesserung der Libido
Einige Frauen berichten von einer gesteigerten sexuellen Lust nach dem Absetzen der Pille.
Nicht alle Frauen sind nach dem Absetzen der Pille vom „Post-Pill-Syndrom” betroffen; die Erfahrungen können von Frau zu Frau variieren. Sollten nach dem Absetzen der Pille anhaltende oder belastende Beschwerden bestehen, ist es ratsam den behandelnden Arzt zurate zu ziehen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.
Wie lange dauert es nach der Einnahme der Pille schwanger zu werden?
Jeder Körper reagiert auf die Hormonumstellung anders. Die Zeit, die nach dem Absetzen der Pille benötigt wird, um schwanger zu werden, kann von Frau zu Frau variieren. In den meisten Fällen normalisiert sich der Menstruationszyklus innerhalb weniger Monate nach dem Einnahmestopp. Statistisch gesehen haben Frauen nach dem Absetzen der Pille dieselbe Wahrscheinlichkeitsrate schwanger zu werden wie diejenigen, die niemals hormonell verhütet haben: eine prospektive Studie des Unternehmens Jenapharm zeigte, dass unabhängig von der vorausgegangenen Anwendungsdauer der Pille, die meisten Frauen schnell schwanger wurden: nach drei Zyklen waren 56 Prozent der Frauen schwanger, nach sechs Zyklen 83 Prozent und nach zwölf Zyklen 94 Prozent. Die Untersuchung umfasste 700 Frauen mit Kinderwunsch, die zuvor für im Mittel 22 Monate mit der Mikropille Valette® verhütet hatten.
Wer übernimmt die Kosten für die Pille?
Da es sich bei oralen Kontrazeptiva um verschreibungspflichtige Medikamente handelt, müssen sie ärztlich verordnet werden – es ist nicht möglich, die Pille ohne Rezept zu kaufen.
Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) bis zum vollendeten 22. Lebensjahr übernommen. Wird die Pille zur Aknetherapie oder aus anderen medizinischen Gründen verschrieben übernimmt die Krankenkasse auch nach dem 22. Geburtstag die Kosten. Grundsätzlich fällt ab 18 eine gesetzliche Zuzahlung in der Apotheke an. Dieser Eigenanteil beträgt 10 Prozent des Packungspreises, jedoch mindestens 5 und höchstens 10 Euro. Die Zuzahlung ist immer pro Packung fällig – unabhängig davon, wie groß die Verpackungseinheit ist.
Viele private Krankenversicherungen orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben, obwohl sie nicht dazu verpflichtet sind. Demnach werden die Kosten für die Pille nur für Frauen unter 22 Jahren getragen – je nach Einkommens- und Beschäftigungsverhältnis kann diese Grenze allerdings variieren. Gewissheit gibt in einem solchen Fall aber immer ein Blick in die Versicherungspolice.
Welche Alternativen zur Pille gibt es?
Prinzipiell wird bei der Verhütung zwischen hormonellen, chemischen und mechanischen Mitteln unterschieden. Hinzu kommen Methoden der natürlichen, hormonfreien Verhütung und Sterilisation. Die Auswahl hängt von den individuellen Bedürfnissen, Vorlieben und gesundheitlichen Umständen einer Person ab. Als Alternative zur Pille bieten sich demnach verschiedene Möglichkeiten an:
Hormonelle Verhütungsmittel
Hormonelle Verhütungsmittel enthalten synthetische Hormone und greifen so in den Hormonhaushalt der Frau ein.
- Intrauterinpessare (IUP)/Spirale
Intrauterinpessare werden in die Gebärmutter eingesetzt und geben dort eine konstante Hormonmenge ab.
- Transdermale Pflaster zum Aufkleben auf die Haut
Hormonhaltige Pflaster werden auf eine saubere, trockene und unbedeckte Körperstelle wie den Oberarm aufgeklebt und verbleiben dort ohne Pause über einen Zeitraum von 21 Tagen. Nach einer 7-tägigen Pause wird ein neues Pflaster aufgeklebt.
- Hormonelle Vaginalringe
Bei einem Vaginalring handelt es sich um einen hormonhaltigen Ring aus einem transparenten, biegsamen Kunststoff. Er wird in die Scheide eingeführt und dort 21 Tage belassen. Im Anschluss wird er entfernt und nach einer 7-tägigen Pause ein neuer Ring eingeführt.
- Hormonimplantat
Hierbei handelt es sich um ein Stäbchen von 4cm Länge und 2mm Durchmesser, das auf der Innenseite des Oberarms unter die Haut implantiert wird und dort maximal 3 Jahre bleibt.
- Die Verhütungsspritze (Dreimonatsspritze)
Die Spritze wird je nach Präparat alle drei Monate in der Arztpraxis in einen Muskel oder unter die Haut der Frau appliziert. Sie enthält ein hochdosiertes Gestagen, das innerhalb der folgenden drei Monate gleichmäßig in die Blutbahn abgegeben wird und eine Schwangerschaft verhindert.
Mechanische Verhütungsmethoden:
Barrieremethoden und Kupferspirale verhindern, dass Spermien zu einer befruchtungsfähigen Eizelle gelangen können.
- Barrieremethoden
In diesen Fällen verhindert eine Barriere, dass Samenzellen in die Gebärmutter eindringen. Der bekannteste Vertreter ist das Kondom. Als preiswerte Verhütungsmethode bietet es gleichzeitig Schutz vor Infektionen. Daneben gibt es weitere Barrieremethoden wie z. B. das Diaphragma, die Portiokappe oder das Frauenkondom (Femidom). Barrieremethoden müssen nur bei Bedarf angewendet werden, setzen allerdings eine korrekte Verwendung voraus. Es ist also eine gewisse Übung und Erfahrung erforderlich.
- Kupferspirale
Bei der Kupferspirale handelt es sich um einen Kunststoffkörper, der mit einem sehr feinen Kupferdraht umwickelt ist. Dieser wird vom Frauenarzt in die Gebärmutter eingesetzt und kann dort bis zu fünf Jahre verbleiben. Das abgegebene Kupfer immobilisiert die Spermien und verhindert so die Befruchtung.
Chemische Verhütungsmethoden:
Chemische Verhütungsmittel töten Spermien in der Vagina ab und werden daher auch als Spermizide bezeichnet. In Form von Zäpfchen, Cremes, Gelen oder Tabletten können sie jederzeit zwischen 10 und 60 Minuten vor dem Verkehr angewendet werden. In der Regel werden Spermizide mit mechanischen Verhütungsmitteln wie einem Diaphragma kombiniert, um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten.
Natürliche Verhütungsmethoden:
Viele Frauen wünschen sich eine natürliche Verhütung, um den Körper nicht mit chemischen oder hormonellen Verhütungsmitteln zu belasten. Hierzu werden die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage innerhalb des weiblichen Zyklus bestimmt. An den fruchtbaren Tagen ist zusätzlicher Schutz, etwa durch Kondome, erforderlich. An allen anderen Tagen ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sehr gering.
- Die Temperaturmethode
Hierbei misst die Anwenderin jeden Morgen zur gleichen Zeit ihre Körpertemperatur (Basaltemperatur) und notiert diese. In der ersten Zyklushälfte liegt die Temperatur niedriger und steigt nach dem Eisprung um wenige Zehntel Grad an. Ist sie an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen höher als in den sechs Tagen davor, hat der Eisprung stattgefunden und die unfruchtbaren Tage beginnen.
Neben analogen Basalthermometern können Anwenderinnen auch auf Temperaturcomputer zurückgreifen. Diese sind etwa handtellergroß, batteriebetrieben und messen die Körperwärme mit einem Thermofühler. Oft werten sie noch zusätzlich Beobachtungen wie die Beschaffenheit des Gebärmutterhals-Schleims oder des Muttermundes und andere Informationen aus.
- Schleimmethode
Durch regelmäßiges Überprüfen des Gebärmutterhalsschleims werden die fruchtbaren Tage ermittelt. Farbe, Konsistenz und ungefähre Menge werden auf einem Zyklusblatt oder einer speziellen Zyklus-App vermerkt. Während sich das Sekret vor dem Eisprung von klebrig-trüb zu flüssig-klar verändert, ist es nach dem Eisprung eher klebrig-trüb.
- Kalendermethode
Diese Methode kann nur bei Frauen angewendet werden, deren Menstruationsblutung regelmäßig ist. Geschlechtsverkehr wird an den Tagen 8 bis 12 des Menstruationszyklus vermieden. Heute gilt diese Methode laut Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als veraltet, da die Berechnungen auf einem 28-Tage-Zyklus basieren. Bei 80 Prozent der Frauen schwankt der Zyklus jedoch.
- Hormoncomputer
Hormoncomputer ermitteln die fruchtbaren Tage, indem sie die Menge bestimmter Hormone im Morgenurin analysieren. Sie eignen sich vor allem für Paare mit Kinderwunsch. Durch geplanten Geschlechtsverkehr an den fruchtbaren Tagen werden die Chancen für eine Schwangerschaft erhöht. Als Hilfsmittel für die Verhütung sind sie jedoch nicht sehr verlässlich, da sie meist kürzere fruchtbare Zeiten im Vergleich zu Temperaturcomputern ermitteln.
- Symptothermale Methode/Natürliche Familienplanung (NFP):
Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus Basaltemperatur, Beobachtung des Zervixschleims und Anwendung der Kalendermethode. Im Vergleich zu den einzel angewendeten natürlichen Verhütungsmethoden gilt die Kombination als recht sicher: Der Pearl-Index liegt bei 0,4 bis 1,8. Sogenannte NFP- oder Zyklus-Apps können die symptothermale Methode ergänzen und die Auswertung der täglichen Messergebnisse sowie die Berechnung der monatlichen Fruchtbarkeitsphase erleichtern.
- Sterilisation (Tubenligatur):
Die Tubenligatur ist eine Methode zur dauerhaften Verhütung. Dabei werden die Eileiter verschlossen und somit zuverlässig und anhaltend vor einer Schwangerschaft geschützt. Eine Sterilisation eignet sich für Frauen, die sicher sind, dass sie keine Kinder (mehr) wollen.
Sonderfall „Pille danach“
Die „Pille danach“ ist seit 2015 ohne Rezept in deutschen Apotheken erhältlich. Zur Notfallverhütung stehen Präparate mit zwei verschiedenen Wirkstoffen zur Verfügung, die nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder einer Verhütungspanne eine ungewollte Schwangerschaft verhindern können.
Dabei greifen sie in das fein abgestimmte Zusammenspiel der körpereigenen Hormone ein. Das synthetische Gelbkörperhormon Levonorgestrel verschiebt den zyklusabhängigen LH-Anstieg und somit den Eisprung. Hat der Anstieg allerdings schon begonnen, kann Levonorgestrel die Ovulation nicht mehr unterdrücken. Die Präparate sollten daher so schnell wie möglich und bis zu 72 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder einer Verhütungspanne eingenommen werden.
Ulipristalacetat verhindert das Andocken des körpereigenen Sexualhormons Progesteron an bestimmte Bindungsstellen im Körper. In Folge kann dieses nicht mehr wirken und der Eisprung wird gehemmt oder verzögert. Im Vergleich zu Levonorgestrel greift dieser Wirkmechanismus auch noch, wenn es bereits zu einem LH-Anstieg gekommen ist. Ulipristalacetat-haltige Präparate können daher bis zu 120 Stunden nach ungeschütztem Geschlechtsverkehr oder einer Verhütungspanne eingenommen werden.
In der Apotheke erhalten Betroffene die „Pille danach“ nach einem ausführlichen Beratungsgespräch. In der Regel wird hierbei auf einen Fragenkatalog zurückgegriffen, mit dessen Hilfe eine bereits bestehende Schwangerschaft ausgeschlossen und die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung ermittelt wird. Des Weiteren wird überprüft, ob Gegenanzeigen oder mögliche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln vorliegen.
Junge Frauen unter 14 Jahren benötigen für den Kauf die Zustimmung ihrer Eltern. Im Alter zwischen 14 und 18 Jahren liegt die Abgabeentscheidung bei der beratenden Apothekerin oder dem Apotheker.
Da Notfallkontrazeptiva nicht der Preisbindung unterliegen können ihre Verkaufspreise variieren. Präparate mit dem Wirkstoff Levonorgestrel sind in der Regel etwas günstiger als Arzneimittel mit dem Wirkstoff Ulipristalacetat.
Auch nach der Entlassung der „Pille danach“ aus der Verschreibungspflicht werden die Kosten bei gesetzlich versicherten Frauen bis zum vollendeten 22. Lebensjahr von der Krankenkasse übernommen – vorausgesetzt, das Notfall-Empfängnisverhütungsmittel wird ärztlich verschrieben.
Es kommt häufig vor, dass die "„Pille danach“ fälschlicherweise mit der Abtreibungspille verwechselt wird. Letztere wird jedoch eingesetzt, wenn bereits eine ungewollte Schwangerschaft besteht. Die „Pille danach“ wirkt verhütend, führt jedoch nicht zum Schwangerschaftsabbruch. Dennoch bietet sie keinen hundertprozentigen Schutz. Ebenso gewährt sie keinen Verhütungsschutz bis zur nächsten Regelblutung nach ihrer Einnahme. In diesem Zeitraum sollte auf nicht-hormonelle Verhütungsmethoden wie beispielsweise Kondome zurückgegriffen werden, selbst wenn die Antibabypille verwendet wird.
[1] Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Artikel verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich – sofern nicht anders kenntlich gemacht – auf alle Geschlechter.
Quellen anzeigen

Linda Künzig, Apothekerin mit Weiterbildungen im Bereich Homöopathie und Naturheilverfahren. Neben ihrer Tätigkeit in einer öffentlichen Apotheke unterstützt sie seit Mai 2019 die Apomio-Redaktion als freie Autorin.